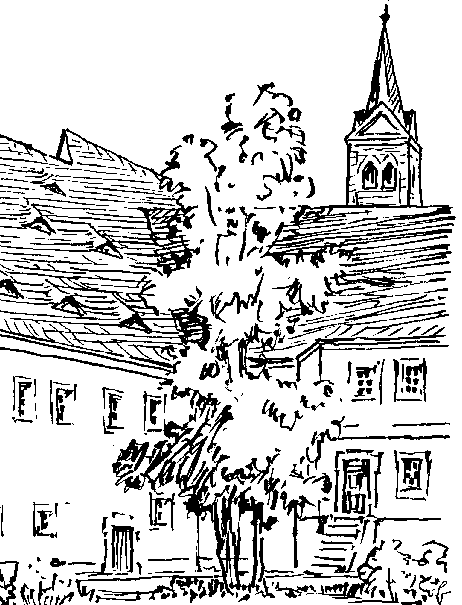14.11.2021 - Vom Richterstuhl Christi - Predigt am Volkstrauertag zu 2. Kor. 5, 1-10 von Pfarrer R. Koller
Kor. 5, 1-10
1 Denn wir wissen: Wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. 2 Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, 3 weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. 4 Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. 5 Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. 6 So sind wir denn allezeit getrost und wissen: Solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn; 7 denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. 8 Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. 9 Darum setzen wir auch unsre Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohl gefallen. 10 Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse.
Es soll ja begeisterte Camper geben, für die es nichts Schöneres gibt, als in einem Zelt in freier Wildbahn zu übernachten. Ich gehöre nicht dazu. Das hat seinen Grund in meiner ersten und dann auch letzten Camping-Erfahrung. Ich war Student in München und wir – das waren ich und drei Kommilitonen – beschlossen, mit 2 Schlauchbooten die Isar von Lenggries aus abwärts zu fahren und in der Jachenau in Zelten zu übernachten. Gesagt, getan!
Das Wetter war herrlich und unsere Bootsfahrt lustig und aufregend zugleich. Als wir aber schließlich mit unseren Schlauchbooten in der Jachenau anlegten, hatte sich der Himmel zugezogen. Wir stellten unsere beiden Zelte auf und hatten dabei schon gegen erste Windböen anzukämpfen. Kaum war unser Gepäck verstaut, die Boote an Bäumen angeseilt, da prasselten schon heftige Regenschauer auf uns herab. Was dann passierte, das lässt sich mit wenigen Worten nur schwer beschreiben. Überall am Himmel zuckten heftige Blitze. Der Donner dazu war so laut, dass du glaubtest, der Boden würde wanken. Aber das Schlimmste war der Sturm! In kürzester Zeit riss er die Zelte aus ihrer Verankerung, ließ eines davon in der Isar verschwinden und zerriss das Zweite.
Wir alle haben die Nacht in pitschnasser Kleidung und erbärmlich frierend verbracht.
Unsere restliche Schlauchfahrt am nächsten Morgen glich einer geschlagenen Armee auf dem Rückzug.
Ja, ein Zelt ist anfälliger und vergänglicher als ein Haus. Wer hätte das besser gewusst als der Apostel Paulus, der von Beruf Zeltmacher war?
In den Zeilen aus dem 2. Korintherbrief, die wir soeben gehört haben, greift er auf das Motiv des Zeltes zurück. Die Lutherübersetzung lässt dies nicht recht deutlich werden, weil sie von einer „Hütte“ spricht. Gemeint ist aber im griechischen Urtext das Zelt, genauer gesagt das Nomadenzelt. „Wenn unser irdisches Haus, dieses Zelt, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel.“ Paulus vergleicht also unseren Körper aus Fleisch und Blut mit einem Nomadenzelt und stellt dieses Zelt dem ewigen, stabilen Haus im Himmel gegenüber. Denn in der Ewigkeit bei Gott, so der Apostel, bekommen wir einen neuen Körper geschenkt, der nicht altert, nicht krank wird, nicht stirbt.
Paulus denkt keineswegs leibfeindlich wie der griechische Platonismus, der den Körper als das Gefängnis der Seele betrachtete. Der Apostel kann den irdischen Leib als vorübergehende Behausung durchaus wertschätzen, hofft jedoch zugleich auf einen neuen und besseren Leib im Himmel. Eine Art von freischwebender Seele im Jenseits kann er sich nämlich nicht vorstellen.
Auch wenn Paulus nicht leibfeindlich denkt, ist dennoch unverkennbar, dass er das Leben auf dieser Erde vor allem als eine Last empfindet. Er wünscht sich, den Leib zu verlassen. Er schreibt vom Seufzen, von der Beschwernis und von seiner Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Er möchte nach Hause, den auferstandenen Herrn schauen, und das so bald wie möglich.
Ich kann Paulus verstehen. In der Tat war sein Leben alles andere als ein Sonntagsspaziergang. Der Apostel war kränklich. Die vielen Reisestrapazen setzten ihm ebenso zu wie die zahlreichen Anfeindungen, denen er sich ausgesetzt sah, die Schläge, die Gefängnis-aufenthalte, die Streitigkeiten in den jungen Gemeinden um seine Person. Außenstehende staunten oft über seine Zähigkeit, mit der er allen Nöten und Gefahren trotzte. Aber ungeachtet dessen wuchs sein Verlangen nach dem Himmel von Jahr zu Jahr.
Mit Schwärmerei hatte dieses Verlangen nichts zu tun. In der Folgezeit wurde es allerdings häufig im Sinne von Weltflucht verstanden und nicht nur Paulus allein, sondern dem Christentum ganz allgemein zum Vorwurf gemacht. Stellvertretend für viele andere Kritiker zitiere ich an dieser Stelle Friedrich Nietzsche: „Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden! Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht. Verächter des Lebens sind es; so mögen sie dahinfahren!“
In den Augen Nietzsches war Paulus der Giftmischer und Lebensverächter schlechthin. Dieses vernichtende Urteil wird dem Apostel gewiss nicht gerecht. Zutreffend freilich ist, dass die Hoffnung ein unverzichtbares Element des christlichen Glaubens ist, die Hoffnung auf ein jenseitiges Zuhause bei Gott ohne Leid und Last.
Bei der Lektüre von Todesanzeigen fällt heutzutage auf, dass von dieser Hoffnung kaum noch die Rede ist. Früher las man oft, der Verstorbene sei „heimgegangen“ – ein tröstlicher Ausdruck. Heute dagegen heißt es zum Beispiel: „Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot; tot ist nur, wer vergessen wird.“ Weiterleben in der Erinnerung derer, die doch auch bald tot sein werden – das scheint mir ein billiger Trost zu sein. Da halte ich es lieber mit Paulus oder auch mit dem katholischen Theologen Romano Guardini, der einmal gesagt hat: „Der Tod ist die uns zugewandte Seite jenes Ganzen, dessen andere Seite Auferstehung heißt.“
Mit der Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten verbindet sich auch die Erwartung des Jüngsten Gerichts. Im Neuen Testament ist oft vom Gericht die Rede und so auch hier bei Paulus: „Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse.“ Heute wird nur noch selten in unseren Kirchen über das Gericht gesprochen, und das aus gutem Grund. Schließlich wurden in früheren Zeiten die Gläubigen allzu oft durch Gerichtspredigten in Angst und Schrecken versetzt.
Viele bildliche Darstellungen setzten das Gericht erschütternd in Szene wie beispielsweise Hieronymus Bosch oder auch Michelangelo auf der Altarwand der Sixtinischen Kapelle.
Musikalisch hat vermutlich der mittelalterliche Hymnus „Dies irae, dies illa“ die größte Wirkung entfaltet – bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts noch eine übliche und zugleich düstere Sequenz in der römischen Totenmesse. Und wenn Sie in unserem Gesangbuch die Strophen des Liedes 149 lesen, dann bekommen Sie einen kleinen Eindruck davon.
So mancher Prediger scheut sich, über das Gericht zu sprechen. Aber damit wird eine zentrale Aussage unseres christlichen Glaubens verschwiegen, nämlich die, wo es von Christus heißt, er werde kommen, „zu richten die Lebenden und die Toten“.
Eine Perspektive, die nicht Furcht auslösen will, sondern ganz im Gegenteil an der Hoffnung festhält, dass es am Ende der Zeit ein Gericht geben wird, in dem der gerechte Gott alles zurechtbringt, was hier auf Erden von Menschen ins Unrecht gesetzt wurde.
Gerade am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr spreche ich diese Hoffnung aus. Staatlicherseits wird der heutige Tag als Volkstrauertag begangen, zur Erinnerung an die zahllosen Opfer von Krieg und Gewalt. Um es in einem alttestamentlichen Bild auszudrücken: Die Stimme des Blutes dieser Opfer schreit noch immer zum Himmel; sie verlangt Gehör und ihr Recht. Ich denke an die Gefallenen und Getöteten der Weltkriege, an die Opfer von Völkermord und Totalitarismus, an die zu Unrecht Inhaftierten, Verfolgten und Versklavten, an die Vertriebenen und Geflüchteten. Und ich denke an alle diejenigen Menschen auf der Welt, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit und deren Wunden sich nicht schließen. Wenn es einen Tag gibt im Jahr, der auf ein Jüngstes Gericht warten und hoffen lässt, dann ist es der Volkstrauertag, dieser Tag, der wie kein anderer von der Schuld und dem Leid der Menschen redet.
Ja, wir hoffen auf ein Jüngstes Gericht. Ein Gericht, in dem das Leid der Opfer gewürdigt und die Täter mit ihren Taten konfrontiert werden. Auch Ihr und mein Leben wird Christus ins Licht rücken. Mag sein, dass es dann auch für uns ohne Beschämung nicht abgeht. Dass es wehtun wird zu erkennen, wie und wo wir schuldig geworden sind, was wir verfehlt oder versäumt haben. Aber diese Erkenntnis ist befreiend und heilsam. Sie macht aus den Bruchstücken unseres Lebens ein Gesamtbild im Licht der göttlichen Liebe. Denn Christus ist größer als unser Herz. Und er richtet nicht, um zu vernichten, sondern um zu vollenden.
Der Dichter Hermann Hesse hat es einmal so gesagt: „Wir Anspruchsvolleren, wir mit der Sehnsucht, mit der Dimension zuviel, könnten gar nicht leben, wenn es nicht außer der Luft dieser Welt auch noch eine andere Luft zu atmen gäbe, wenn nicht außer der Zeit auch noch die Ewigkeit bestünde.“
Auch ich bekenne mich zu dieser Sehnsucht. Und auch zu diesem Anspruch. So viel bin ich mir wert!
Aber was noch viel wichtiger ist: So viel bin ich Gott wert!