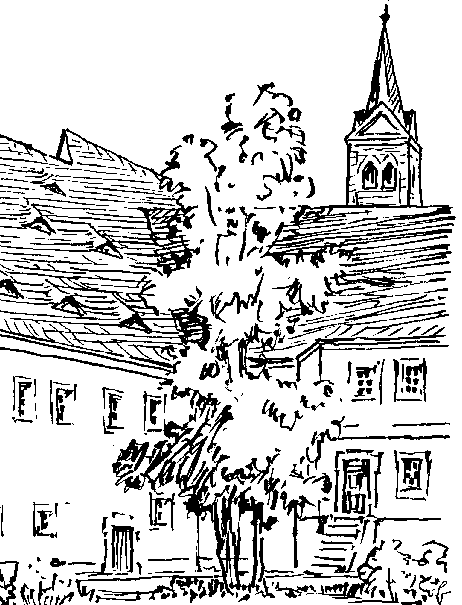14.05.2023 - „Liberalitas Bavarica“ Predigt zu 1.Tim 2,1-6a am Sonntag Rogate (Vikar Fabiunke)
Liebe Gemeinde,
„Frieden auf Erden“: was dieser bedeutet und wie wir diesen erreichen, scheint uns eben vermittelt worden zu sein.
Von der ersten Zeile an darf unsere Predigttextstelle aus dem 1. Timotheusbrief wohl mit Fug und Recht als unzeitgemäß charakterisiert werden.
Könige und Obrigkeiten, der Wunsch nach Ruhe und einem frommen Leben passen nicht in unser heutiges gesellschaftliches Harmonieverständnis. Was, wenn ich gar keine Ruhe will, sondern Action? Was, wenn ich mit dem Beten gar nicht so viel am Hut habe? Soll nicht jeder nach seiner Façon glücklich werden können? Meinetwegen der eine im Kloster, und der andere im Berliner Nachtleben?
Ich verweile noch ein wenig bei dem Bild, welches der Text durch meine Einbildungskraft erzeugt hat. Was ist übrig geblieben? Ja klar, irgendwo ist da Jesus Christus. Doch anders als sonst, will meine durch die Worte angeregte Fantasie diesen nicht so recht ins Bild setzen. Die fantastischen Nachbilder des Textes werden von anderen Elementen dominiert.
Ich stelle eine merkwürdige Ähnlichkeit zwischen den Motiven dieses Paulusbriefes und denen des Bayern-Marketings fest. Was ist es eigentlich, dieses Bayern Image? Sie kennen es ganz bestimmt. Aber lassen Sie es sich nochmal von einem gebürtigen Südhessen erklären: Wenn man für den Freistaat oder eines seiner typischen Produkte (BMW einmal ausgenommen) wirbt, so begegnet man wiederkehrenden Bildern: Schöne Landschaften, die Landwirtschaft und ihre Leute, kinderreiche Familien, Recht und Ordnung, Fest und Frohsinn, und ja, Gott!
Im Bayern Marketing werden weiche Bilder einer funktionierenden, ländlich geprägten Lebensform gezeigt. Die Paulaner Werbung aus dem Münchner Paulaner Garten macht letztlich nichts anderes, als ländliche Gemütlichkeit in die Großstadt zu transponieren.
Ach ja, und berühmte Könige von Gottes Gnaden oder solche, die sich dafür halten, hatte und hat das Land ja bis heute. Immerhin: aktuell residiert in München ein Protestant.
Da liegt es also vor meinem inneren Auge, dieses Bild, das Paulus mir mit seiner Sprache gezeichnet hat: Freundliche Wolken ziehen über das Land, die Felder sind abgeerntet, das Ende eines warmen Spätsommertages. Und es will Abend werden in diesem Bild. Die Kirchglocken holen die fleißigen Hände vom Feld. Auch in mir erzeugt dieses Bild einen inneren Frieden. Utopisch? Nein! Romantisch? Durchaus.
„So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue: Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen,
für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit.“
So rät uns Paulus. Ich bin ja geneigt, der historischen Rezeption dieses Textes unter den revolutionär gestimmten evangelischen Pfarrern der 70er Jahre mal nachzugehen. Da hat Paulus so manchem Christen ein ganz schönes Ei ins Nest gelegt.
Aber Zweifel sind in der Tat berechtigt. Nicht zuletzt haben deutsche Protestanten zwischen 1933 und 1945 ganz eifrig für ihren Führer von Gottes Gnaden gebetet. Und so mancher fuhr damit gut, hatte so wahrlich „ein ruhiges und stilles Leben führen können.“
Der Predigttext ruft aber nicht zur scheinfrommen Vereinzelung, zum trügerischen und diabolischen Frieden auf. Er taugt nicht zur göttlichen Rechtfertigung eines brandschatzenden und mordenden Diktators. Vielmehr sichert er in seinen Worten den wahren Gottesdienst, indem er Christus als Stifter eines wahrhaft egalitären Geistes ausweist.
Ein von Gott eingesetzter Herrscher achtet das göttliche Gesetz und handelt nach Christi Vorbild, welchen Gott als Bindeglied oder „Mittler“ zwischen sich und uns eingesetzt hat. Er achtet, dass Jesus Christus uns gezeigt hat, dass Gott die Schwachen schützt und das Verlorene sucht. Er weiß um Gottes Macht und die Nichtigkeit seiner irdischen Befugnisse. Tag für Tag erinnert er sich seiner besonderen Verantwortung, die aus seiner hervorgehobenen Stellung erwächst.
Einen solchen Herrscher stelle ich mir als jemanden vor, der wiederum selbst „vor allen Dingen Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung“ nicht vergisst.
Im Herbst entbrannte eine Diskussion um die Kuppel des wieder errichteten Berliner Stadtschlosses. Die Kulturstaatsministerin und andere stießen sich an der Neuinstallation des historischen Schriftzuges:
„Es ist keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.“
Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. ließ ihn seinerzeit als Kombination zweier Bibelstellen, nämlich Apg 4,12 und Philipper 2,10, anbringen.
Der Vorwurf der Kulturstaatsministerin: christliche Exklusivität, Ausdruck religiöser Intoleranz, und ein übersteigerter Herrschaftsanspruch des preußischen Königs.
Dabei war man blind für die historisch plausibleren Beweggründe: viel eher wollte doch der preußische Herrscher demutsvoll seine eigene Unterwerfung zum Ausdruck bringen. Jesus war auch sein Heiland. Wenn sich im Namen Christi alle Knie, „die im Himmel und auf Erden und unter der Erde“ beugen sollten, ja so mussten sich auch die Knie eines preußischen Königs vor ihm beugen. Wäre dieses Spruchband um die Kuppel des Berliner Stadtschlosses in der deutschen Geschichte beherzigt worden, so manches wäre der Welt erspart geblieben.
Die Anweisung zu „Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung“ vor allen Dingen und für alle Menschen und Herrscher reiht sich im 1. Timotheusbrief in eine von Paulus erdachte Gottesdienstordnung der ersten christlichen Gemeinden ein. Die verborgenen Gottesdienste im Herzen, welche besonders wir evangelischen Christen alltäglich und allerorts zu feiern trachten, dürfen hier mit gutem Recht mitgedacht werden.
Ich denke mir die im 1. Timotheus beabsichtigte Christengemeinde als solidarische Gemeinde. Eine demgemäß handelnde christliche Gesellschaft stelle ich mir als solidarische Gesellschaft vor. Ja, sie bekennt sich zu unterschiedlichen Ausgangslagen der Menschen, oder unterschiedlichen Ständen, wenn man so will. Das auf Grundlage des Bibeltextes eingangs gezeichnete Idyll ist also kein sozialistisches oder gar kommunistisches. Und dennoch finden sich in diesem Bild „Gleichheit“ und „Brüderlichkeit“.
Der Mensch, der sich „vor allen Dingen“, welche er verrichtet, auf „Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung“ besinnt, der sagt von sich:
„Ich weiß meine Zukunft allein in Gott, darum bitte ich!“
„Ich weiß um meine Armut und Fehlbarkeit, ja meine Begrenztheit, darum bete ich.“
„Ich weiß um Gottes Forderungen in Bezug auf meinen Nächsten, und dass sich Gott selbst in meinem nächsten Menschen zu erkennen gibt, darum halte ich Fürbitte. Was diesem geschieht, dass kann schon heute mir zufallen.“
„Ich weiß dass alles aus Gott fließt und ich selbst nur in ihm meinen Ursprung habe, darum danke ich.“
Demut und Selbstbegrenzung vor Gott lassen trotz aller Unterschiede zwischen den Menschen Gesellschaften „ruhig und still“ gedeihen. Selbstsucht, Neid und maßlose Überschätzung der eigenen Fähigkeiten wiederum münden in einem unerträglichen Alltag und führen längerfristig zu seelischem Schaden.
Indem ich mich eifernd überschätze nehme ich anderen die Luft zum Atmen. Immer wenn ich meine, was ich habe und bin sei allein mein Verdienst, lastet das Joch der kommenden Niederlage umso schwerer. Dann bin ich ganz eingenommen von meinem Scheitern, und kann mich nicht aufmachen, mit Gott frohgemut neue Wege zu gehen. Wenn ich nur auf mich, und meine eigene Entwicklung statt auf das Allgemeinwohl schaue, dann vergesse ich, was mein Nachbar von mir braucht.
Jeder von uns soll gemäß unseres heutigen Textes zur Wahrheit kommen können. Dafür muss gewährleistet sein, dass er oder sie in seinem oder ihrem ganz eigenen Rhythmus schwingen kann.
Spätestens nach der getanen Arbeit des Tages sollen wir alle zusammen kommen können und erkennen dürfen, wie wir in großer Unterschiedlichkeit zusammen gewirkt haben. Wir haben dabei unserem Nachbarn seinen Freiraum zugestanden, ihn in seinen Talenten geschätzt, dabei aber niemals vergessen, von wem wir alle stammen und auf den wir alle zugehen.
„Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“, die Kampfbegriffe der weltlichen französischen Revolution erfahren im 1. Timotheus eine christliche Wendung.
Denken Sie sich nun im Sinne des Marketings eine lange Biertischgarnitur, ein Festzelt, einige „Seidla“ Bier, angeregte Gespräche, und schwungvolle volkstümliche Musik. Jetzt setzen Sie bitte an diesen vorgestellten Tisch alle Milieus der Stadtgesellschaft und Sie sind in Bayern.
Amen.