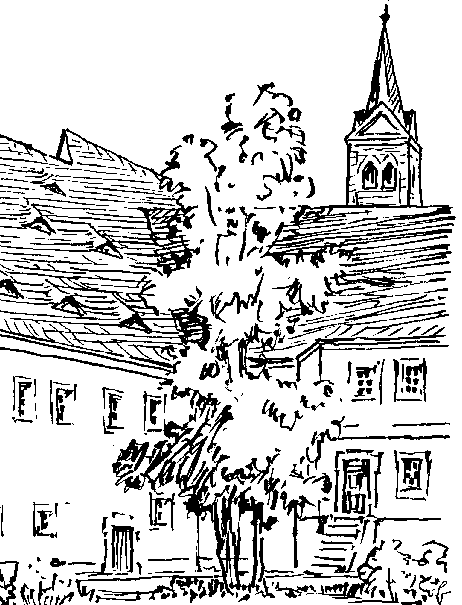21.04.2025 - "Vom Geschmack der Osterhoffnung" - Predigt zu Jes 25,6-9 am Ostermontag von Pfrin Sr. Elise Stawenow
Der Predigttext steht im Propheten Jesaja im 25. Kapitel. Ich lese aus der Übersetzung der BasisBibel.
6Der Herr Zebaot wird allen Völkern
auf dem Berg Zion ein üppiges Festmahl bereiten.
Es wird erlesene Weine und würzige Speisen geben. Man trinkt gut gelagerte, alte Weine.
7Dann vernichtet Gott auf dem Zion den Trauerschleier,
der allen Völkern das Gesicht verhüllt.
Er entfernt das Tuch, das sie alle bedeckt.
8Gott, der Herr, wird den Tod für immer vernichten
und die Tränen von allen Gesichtern abwischen.
Er nimmt seinem Volk die Schmach,
unter der es auf der ganzen Erde gelitten hat.
Ja, das hat der Herr gesagt.
9Zu der Zeit wird man sagen:
Seht, das ist unser Gott!
Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt,
und er hat uns geholfen.
So ist der Herr, auf den wir gehofft haben.
Lasst uns fröhlich sein und über seine Hilfe jubeln.
Lasst uns in der Stille um den Segen Gottes bitten.
… Gott, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen.
Liebe Gemeinde!
Ich fragte die Kinder meiner 4. Klasse, worauf sie sich in der Festzeit so freuen. Nach kurzer Zeit begannen die Kids, mir die Speisepläne ihrer Familien zu referieren. Und einer übertraf den andern,
Braten über Braten, Klöße natürlich und Bratwürstchen. Die ganze Palette oberfränkischer Hausmannskost. Zugegeben, es ging um die Weihnachtsfesttage, aber ich fragte mich doch: Ist ein christliches Fest nicht mehr als eine üppige Speisekarte?
Sicher, ist es das. Doch heute am 2. Osterfeiertag hält die Bibel verkopft-asketischen Christenmenschen wie mir vor, dass der Gaumen eine nicht unwesentliche Rolle spielt:
Zwei Jünger erkennen erst in dem Moment, wo es ans Essen geht, dass Jesus an ihrem Tisch der dritte ist.
Der Prophet Jesaja entwickelt ein Hoffnungsbild von einem großen Festmahl mit allen Völkern: Da triefen die Speisen von Fett. Der Wein fließt in rauen Mengen.
„Das kann doch nicht gesund sein!“ mag man da einwenden. Und mein Theologenhirn zitiert dazu aus dem Römerbrief: „Das Reich Gottes ist nicht essen und trinken.“ (Röm 14,17). Stimmt sicher.
Und doch materialisiert sich die frohe Botschaft im Essen und Trinken.
Das Abendmahl als Ort der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Als Akt der Versöhnung. Als Hoffnungsbild für zukünftige Zeiten.
Beim Hoffnungsbild setzt der Prophet Jesaja an. Den Abschnitt, aus dem der Text stammt, nennt man auch Jesaja-Apokalypse. Apokalypse – also eine Beschreibung des Zustands der Welt „danach“, nach der Welt.
Wir gehen davon aus, dass die Welt derer, die diesen Text niederschrieben, aus völlig gegenteiligen Erfahrungen bestand: Die Stadt Jerusalem – ein Trümmerhaufen. Das Volk zum Teil zerstreut im Exil oder unter widrigen Bedingungen im zerrütteten Land lebend. ---
Schmählich mussten sie feststellen, dass „ihre“ Stadt mit dem Berg Zion, wo doch Gott wohnen sollte, niedergegangen ist. Wo bleibt die Hoffnung? Wo die Zukunftsperspektiven?
Neue Generationen verarbeiten die Erfahrungen. Sie geben die Hoffnung nicht auf und machen neue Hoffnungs-Perspektiven groß.
In meiner Familie wird von Kuchenrezepten erzählt, die meine Urgroßmutter und ihre Generation während der schweren Kriegsjahre notierte: Stollen mit Butter über Butter und Zucker ohne Ende! Allein die Vorstellung, dass man davon wieder in Hülle und Fülle haben könnte, lässt den Speichel fließen. Es sind Sehnsuchts-Rezepte. Einen ähnlichen Hintergrund hat der prophetische Text. In einer Mangelerfahrung lebt die Vision auf: Ein „fettes Mahl von reinem Wein, Fett und Mark“, wie Luther übersetzt.
Fernab vom Speiseplan entdecke ich drei wesentliche Perspektiven:
- Alle an einen Tisch
Allen Völkern wird auf dem Berg Gottes das Festmahl bereitet.
Stellen Sie sich das mal vor: Eine Tafel voller paradiesischer Speisen. Nebeneinander sitzen Israelis und Palästinenserinnen, russische Menschen neben Ukrainern. Und die, die gegen die afghanischen Schutzsuchenden gewettert haben, die die alte Regierung wie versprochen in Deutschland aufnimmt, unterhalten sich freudig mit ihnen.
Diese Idee kommt nicht nur „von oben herab“, sie verbreitet sich unter Menschen, die selbst betroffen sind - zutiefst gekränkt und geschmäht wurden. Schon das allein scheint ein Wunder.
- Befreit vom Schleier der negativen Weltsicht
Wir hören von einem Schleier, der von allen Völkern weggenommen wird.
Ich stelle mir diesen Akt vor wie eine OP am grauen Star. Über lange Zeit hat sich das Augenlicht – meistens sehr unmerklich – getrübt. Und damit auch die Weltsicht. Trauer, die sich zu Bitterkeit verwandelt. Schmerz, geweint oder ungeweint, der hart macht. Die Not, die Erfahrungen des Todes verursachen. Das alles lässt die Welt durch einen grauen, nebligen Schleier sehen. Die OP tut Wunder. Plötzlich wieder klar sehen. In hellen Farben. Es ist der absolute Perspektivwechsel. Im neuen Licht hat der Tod keine Macht.
- Der Gastgeber beweist sich
Alle an einen Tisch. Vom grauen Schleier der negativen Weltsicht befreit. Das kommt nicht von ungefähr. Es ist nur möglich, weil der Gastgeber Gott selbst ist. Er deckt den Tisch. Er nimmt den Schleier weg. Er schenkt das Erkennen: Der Tod ist nicht das Ende. Der Feindschaft ist der Boden entzogen. Gott wird abwischen alle Tränen! Der Schleier ist weg: Der Gott des kleinen Volkes der Israeliten zeigt seine verwandelnde Lebenskraft – für alle Menschen. Er stellt Würde wieder her – für sein Volk.
Alle an einem Tisch. Befreit vom Schleier der negativen Weltsicht. Der Gastgeber Gott lädt ein
So schön, so gut.
Worte, die fernab jeder Realität sind?
Ja, das sind sie. Das macht eine Vision aus. Sie schaut in die Ferne, nicht in die Realität.
Aber sie macht auf Aspekte der Realität aufmerksam:
Alle Nationen an einem Tisch, ist vielleicht hochgegriffen: Aber wöllte ich mit dem Nachbarn oder der Kollegin, die über mich herzieht, wirklich an einem Tisch sitzen
Wo verzerrt der Schleier der negativen Weltsicht meinen Blick auf die Realität?
Und: Würde ich mich einladen lassen von einem Gastgeber, der permanent die Grenze des Möglichen überschreitet?
Liebe Gemeinde,
während ich den Teig für das Osterbrot formte, gingen mir diese Fragen durch den Kopf.
Die Vision braucht Anknüpfungspunkte im Hier und Jetzt.
Das ist nicht zuletzt der Gaumen.
Friedrich Schleiermacher sprach von Religion als „Sinn und Geschmack für das Unendliche“.
Die Vision des ewigen Heils sucht fühlbare Erfahrung im alltäglichen Leben.
Sie zu finden ist schwer und unverfügbar. Zwei Jünger wandern 10 km lang mit einem Fremden, trauernd, klagend, debattierend. Vernebelt vom Schleier, der ihre Augen glasig macht.
Erst in dem Moment, wo sie was in den Händen halten – nämlich Brot, das er, der Gastgeber im eigenen Haus, gebrochen hat. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen.
Das gemeinsame Essen und das Teilen des Brotes, hat sich in ihnen eingeschrieben als Ort der Hoffnung.
Ich meine, das ist die Botschaft für uns heute: Wer Sinn und Geschmack für die Hoffnung entwickeln möchte, braucht Orte dafür.
Der Tisch – mag er üppiger oder weniger üppig gedeckt sein – ist ein Ort dafür.
Am Ostermontag stehen wir im Übergang vom Osterfest zum Alltag. Während sich in der Osternacht die Botschaft des Auferstanden noch sphärisch und geheimnisvoll verkosten lässt, will der Ostermontag Fakten. Wo und wie kann ich die große Hoffnung in den Alltag hinüberretten?
Ich kann Gottesmomente nicht selbst erzeugen, aber ich kann die Erinnerung stark machen.
Vielleicht kennen Sie es, dass ein Gericht Sie an gute (oder auch schwierige) Erlebnisse erinnert. Bei Kirschpfanne denken ich an warme Sommeressen auf den Balkon, aber auch an einen verbrannten Gaumen von den heißen Kirschen. Der Duft von frischer Apfelminze erinnert mich an „meine erste Liebe“. Denn so roch das Kloster, als ich es kennenlernte. Dort wurde der Tee wurde auf dem Dachboden getrocknet. Und Pflaumenmustaschen backe ich in Erinnerung an meine verstorbene Großmutter. Mit der „guten Butter“ hatte sie immer ihre ganze Liebe eingebacken.
Auf ähnliche Weise geht es darum, den Geschmackssinn für die göttliche Vision zu erlernen. Was schmeckt nach dieser Hoffnung? Womit verbinde ich sie?
Das gebrochene Brot. Süßer Wein. Das sind Erinnerungen, die sich tief mit dem Glauben an den Gekreuzigten und Auferstandenen verbunden haben.
Wir erinnern und vergegenwärtigen uns das im Abendmahl.
Das ist – theologisch ausgedrückt – präsentische Eschatologie: Für das, was zuletzt – nach dieser Welt einmal sein wird – bekommen wir hier und jetzt einen Vorgeschmack, es wird erfahrbar. Greifbar.
Wir feiern heute im Gottesdienst kein Abendmahl. Doch jedes Brot lädt ein zum Hoffnungsbrot zu werden. Ich habe ein Osterbrot mitgebracht. Als Zeichen. Zur Erinnerung. Im jüdischen Passahmahl teilen die Gläubigen das Tränenbrot – harte Brot, das sie an den Auszug aus Ägypten erinnert. Wir backen an Ostern süßes Brot: Oft in Form eines Zopfes zum Zeichen der Dreiheit Gottes, die in sich eines geworden ist. Als Zeichen, das sich auf solch eine Weise Gott mit uns verbinden will. Fest verwoben. Jesus Christus, den Auferstandenen schmecken und teilen schafft Geschmack für das Unendliche: Denn Tod, Tränen und Trauer werden nicht für immer regieren. Alle haben Platz am Tisch des Herrn. Befreit vom Schleier der negativen Weltsicht. Denn Gott lädt ein. Amen.