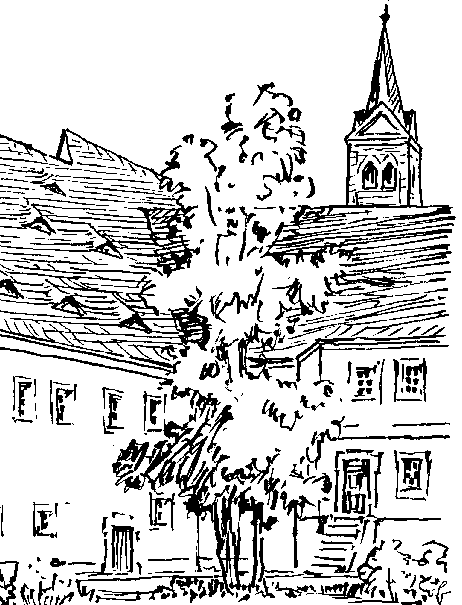31.08.2025 - Streiten mit Gott!? - Predigt zu Hiob 23 (Pfrin. Sr. Elise Stawenow)
Predigt zum 11. Sonntag nach Trinitatis am 31.08.25
Friedenskirche Zedtwitz/Hospitalkirche Hof
zu Hiob 23, Pfrin. Sr. Elise Stawenow
Liebe Gemeinde!
Eines meiner Highlights der letzten Woche war eine Kirchenführung in Weißenstadt.
Es ist keine besondere Kirche. Eine Markgrafenkirche, längst nicht so kunstvoll ausgestattet wie unsere (hier) in Hospital.
Aber es gibt eine Besonderheit: „Das hier – sagte der Pfarrer bei der Führung – sind die Trutzbänke.“ Er zeigte auf die Bankreihen unter der Empore, die durch einen Gang von den anderen getrennt waren. „Trutz-Bänke? Das hab ich ja noch nie gehört.“
„Hier“, erklärte er, „nahmen Menschen Platz, die einen schweren Trauerfall in der Familie hatten. Die allen Grund hatten, trotzig zu sein. Sie zeigten damit demonstrativ, dass sie wütend auf Gott sind..“
Diese Trutz-Bänke erzählen, dass in der Kirche Platz ist für alle, die mit Gott hadern. Die zweifeln. Und mit ihm streiten.
Heute ist so jemand unter uns im Gottesdienst. Er sitzt demonstrativ auf der Trutz-Bank. Er wurde seiner gesamten wirtschaftlichen Existenz beraubt. Alle seine Kinder sind plötzlich ums Leben gekommen. Dann wird er selbst krank. Der ehemals reiche und ehrbare Mann hat alles verloren. Und dabei hat er weder was Unrechtes, noch was Falsches getan.
Er ist nicht allein. Zum Glück. Drei Freunde hören von den „Hiobsbotschaften“, die den Freund treffen und kommen, um ihm beizustehen. Sie verharren neben dem verzweifelten Mann, 7 Tage lang und 7 Nächte lang. Schweigend. Nachdem Hiob das Schweigen bricht und sein Leben verflucht, setzen auch die Freunde zu Erklärungen an:
Wie kann es sein, dass du, der du so vielen Menschen Mut zugesprochen hast, jetzt an deinem Elend zerbrichst?
Du weißt doch: „Unheil kommt nicht von nichts.“
Also, du bist doch sicher selbst schuld dran!
Sie wollen trösten, doch Trost ist das nicht.
„Es wird schon zu was gut sein!“ höre ich bei Trauergesprächen. Oder: „Wenns der Herrgott so will, muss ich mich fügen.“
Doch: Will der Herrgott dieses Leid?
Das Buch Hiob ist ein poetischer Erklärversuch auf die allergrößte Frage der Theologie. Warum lässt Gott Leid zu? Hiob ist eine literarische Figur. Gesteigert ins Extrem, steht er exemplarisch für unsere menschlichen Erfahrungen.
Die Figur des Hiob wird mir zum Vorbild. Nicht als frommer Mann – der ist er auch, denn er beschimpft Gott nicht. Er wird zum Vorbild als einer, der es wagt mit Gott zu streiten:
2Auch heut bleib ich beim Widerspruch,
das ist der ganze Inhalt meiner Klage.
Und seufze ich, liegt es an Gottes Hand,
die mich noch immer niederdrückt. (Hi 23,2 BB)
Heißt es im Predigttext aus Hiob im 23. Kapitel.
Drei Streitpunkte greife ich auf:
1. Gott ist der Allmächtige.
Davon geht Hiob aus. Gott ist der Schöpfer der Welt und der Urheber seines Leides. Hiob spricht Gott als „den Allmächtigen“ an. Aber nur auf dem ersten Blick. Auf dem zweiten Blick – und da braucht man den hebräischen Urtext, redet Hiob Gott nie mit „Allmächtiger“ an. „Schaddaj“ sagt er zu Gott. Ein alter archaischer Göttername, der mit Macht assoziiert wird. Mit diesem Gottesbegriff macht der Poet darauf aufmerksam, dass es um eine Erzählung aus alten Zeiten geht - dass die Erzählung von Hiob eine fiktive Legende ist. Der „Allmächtige“ ist eine Erfindung der Theologie, die viele Anknüpfungen in den Bibeltexten hat. Aber erst die griechische Bibel übersetzt „Schaddaj mit Pantokrator – Weltenherrscher. So scheint die Allmacht Gottes für alle Zeiten göttlich verfügt.
Allmacht kann vernichtend sein. Herrscher spielen sich mit Allmachtsgebaren auf: Wenn Putin die nächste Großoffensive startet und die gefallenen Soldaten feiert. Und Trump eine aggressive Zollpolitik nicht mal vom Gericht hinterfragen lässt.
Eine Frau erzählte mir vom Verlust ihrer Mutter. Sie war ein 16Jähriges Mädchen, das plötzlich ohne Mutter dastand. Der Pfarrer sagte bei der Beerdigung, dass Gott spricht: „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und meine Wege sind nicht eure Wege.“ Also – schlicht und ergreifend: Schickt euch in den Willen Gottes. Bis in das Alter erinnert sie diesen Satz.
Das ist Allmacht: Wenn der Mächtige keinen Widerstand bekommt und das Gegenüber klein beigeben, demütig sein muss. Auf solche Weise wird der Gedanke von Gottes Allmacht missbraucht.
Annette Buschmann, Pfarrerstochter, die Missbrauch erlebt hat, dichtet in einem Gedicht mit der Überschrift „Allmächtiger“. Ich lese einen Auszug:
Gottvater –
Wenn ich einst tot bin nach meinem Leben
und dir begegnen werden
dem Allmächtigen
der ohne Sünde ist
Und du mich fragst nach meinem Leben
mir meine Schuld vorhältst
mein nicht gelebtes Leben
meinen Mangel an Liebe
meinen fehlenden Glauben
mein uraltes Misstrauen
meinen andauernden Hass
Dann wisse
ich werde mit meiner Rechnung kommen
mit den Gebeten meiner Kindheit
die ungehört verhallt sind
in einem leeren Kosmos
Wo warst du?...
Wisse Allmächtiger
ich werde dich fragen
nach dem Tod
vor meinem Leben
in meines Vaters Haus
Aus: Annette Buschmann/Andreas Stahl: Unsagbare Worte. Trauma, Poesie und die Suche nach Gott, 117f.
Der Text zeigt ihren Mut, im Aufstand gegen Gott an ihm festzuhalten.
In Gesellschaft und Kirche diskutieren wir aktuell immer wieder über gesunden Machtgebrauch.
Macht hat Potential, wenn das Gegenüber die Macht erwidert und die eigene Macht positiv entgegensetzt und so Synergien und Kooperation geschieht. Macht kann für eigene Zwecke missbraucht werden, leider auch die Religion, gerade in der Allmachtstheologie.
Annette Buschmann macht eine Kampfansage: Gott möge beweisen, dass er anders ist. Da macht sie sich mit Hiob eins.
Denn Hiob setzt der erfahrenen Macht Gottes seine Macht entgegen – die Macht der Klage. Das ändert nicht die Situation. Das ändert aber die Haltung: Hiob hat was zu sagen. Er hat ein Recht, in seiner Unrechtserfahrung gesehen zu werden. Er lebt Selbstermächtigung in der Ohnmacht. Die Allmacht Gottes – so meine These – ruft zum Widerstand auf.
Hiob sagt:
3Ach, wenn ich doch nur wüsste, wo ich ihn [Gott] finde.
Dann ging ich hin zu seinem Richterthron.
4Ich würde meinen Rechtsfall vor ihn bringen
und ihm die Gründe nennen, die mich entlasten.
5Dann wird er mir Rede und Antwort stehen.
Ich möchte verstehen, was er mir zu sagen hat.
6Ob er mich dann mit Gewalt in die Schranken weist?
Nein! Er wird bestimmt Rücksicht auf mich nehmen.
7Dann kann ich offen und ehrlich mit ihm streiten
und dort mein Recht für immer durchsetzen.
8Doch wenn ich nach Osten gehe, ist Gott nicht da.
Auch im Westen kann ich ihn nicht finden.
9Im Norden bekomme ich ihn nicht zu fassen,
und auch im Süden seh’ ich ihn nicht. (Hi 23,3-8 BB)
2. Gott ist nicht da
Der zweite Streitpunkt. Denn so fühlt Hiob. Er dreht sich im Kreis. Er kann Gott, von dem er Gerechtigkeit erwartet, nicht finden.
Wo Gott versprochen wurde , die rettende Kraft, ist Leere. So erlebt es auch „Hiob im Diakonissenkrankenhaus“. Er ist ständig umgeben von netten Menschen, die erzählen „Gott liebt dich“. Doch die Erfahrung, die er mit der Krankheit macht, ist eine andere. Robert Gernhardt sagt in seinem Gedicht:
Ihr habt mir tags von Gott erzählt,
nachts hat mich euer Gott gequält.
Ihr habt laut eures Gotts gedacht,
mich hat er stumm zur Sau gemacht.
Ihr habt gesagt, daß Gott mich braucht –
braucht Gott wen, den er nächtens schlaucht?
Ihr habt erklärt, daß Gott mich liebt –
liebt Gott den, dem er Saures gibt?
https://www.planetlyrik.de/lyrikkalender/robert-gernhardts-gedicht-hiob-im-diakonissenkrankenhaus/, 30.08.25
Das sind schockierend deftig-heftige Worte, für die Erfahrung: Gott ist nicht da. des Hiob. Es ist nur konsequent, Gott die Existenz abzusprechen.
Robert Gernhardt negiert Gott in seinem Gedicht. Das kann alles nicht wahr sein. Aber er gibt ihm einen Raum, indem er ihn nennt. Das ist Auseinandersetzung. Bewegung in einer festgefahrenen Situation.
Hiob setzt da noch eins drauf. Er sucht Gott: Im Osten, Westen, Süden und Norden. Er sucht ihn in Raum und Zeit. Im Zurückliegenden und im Kommenden, so die hebräische Metaphern der Himmelsrichtungen.
Die Erfahrung „Gott ist nicht da“ hindert Hiob nicht, Gott zu suchen.
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ betet Jesus am Kreuz. Da ist nix. Doch allein dass Jesus Worte für diese Nix hat, baut eine Verbindung. Zu dem Gott, dessen Leerstelle so schmerzhaft ist.
17Doch die Finsternis reicht nicht aus,
um mich zum Schweigen zu bringen.
Auch wenn vor mir alles im Dunkeln liegt,
hält mich das nicht zurück. (Hi 23,17)
So dichtet Hiob. Er gibt nicht auf. Und er bekommt Recht. Das ist der dritte Streitpunkt:
3. Hiob hat Recht
„Deine Freunde haben nichts Wahres über mich geredet.“ (Hi 42,7) sagt Gott, nachdem er mit Hiob aus dem Wettersturm heraus diskutiert hat.
Hiob hat Recht. Er hat das Recht mit Gott zu rechten. Gott erscheint im Wirbelsturm und erklärt Hiob die Welt: Sie so ist wie der Sturm, wirbelig, lebendig, und durchaus verwirrend. So die US-amerikanische Theologin Catherine Keller. (Geheimnis, 118).
„Will der Herrgott dieses Leid?“ – Ich denke nein. „Könnte es sein, dass Gott nicht unser Leiden will, sondern eine Welt, die als lebendiges, offenes, wirbelndes System besteht?“ (Keller, Geheimnis, 118)
Wo Kräfte miteinander ringen, Synergien entstehen und Neues entstehen kann, indem eine Kraft mit der anderen kooperiert?
Das Leiden bleibt da. Es bleibt schwer. Aber es hat keinen Sinn. Auch nicht bei Gott.
Schluss
Ich sehe Hiob auf der Trutzbank sitzen. Die Bank hier ist nicht hinten am Ende der Kirche, abgeschottet vom Rest der Gemeinde, sondern mitten drin. Hiob ist einer von uns. Jede Bank darf eine „Trutzbank“ sein.
Das Orgelvorspiel beginnt. Hiob hört das Lied: „Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit.“ (EG 369)wet
Stimmt nicht – denkt er aufbrausend. Und dann im nächsten Moment besänftigt: Doch.
Weil Gott mich ernst nimmt. Und ich ihm meine Wut entgegenschleudern kann.
Weil Gott sich mit mir verbindet, wenn ich ihn nicht fühle.
Weil Gott mir Recht gibt.
Deshalb bleibt wahr:
„Denk nicht in deiner Drangsalshitze, dass du von Gott verlassen seist.
Denn welcher seinem Gott vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut.“ (EG 369)
Amen.