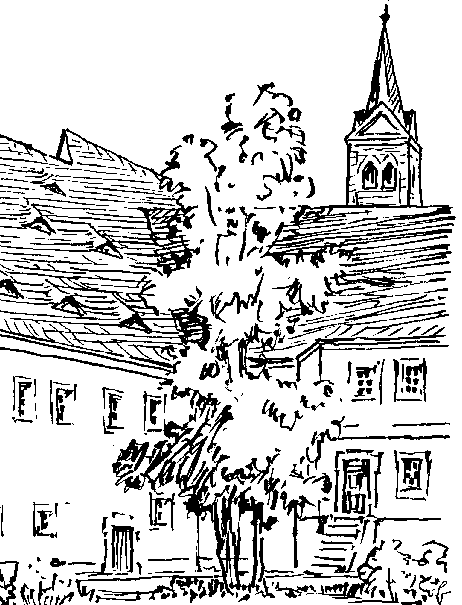19.10.2025 - "Luthers Apfelbäumchen" - Predigt zu 1.Petrus 4,7-11 am 18. Sonntag nach Trinitatis (Pfarrer Fischer)
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
Liebe Gemeinde!
„Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen!"
Mit diesem oft gehörten Ruf beginnt der Text aus dem 1. Petrus-Brief, der unserer Predigt heute zugrunde liegt:
Wir hören aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11:
7Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet.
8Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe; denn »Liebe deckt der Sünden Menge zu« Spr 10,12.
9Seid gastfrei untereinander ohne Murren.
10Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes:
11Wenn jemand redet, rede er’s als Gottes Wort; wenn jemand dient, tue er’s aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
Liebe Gemeinde,
„Das Ende aller Dinge ist nahegekommen!"
Wie oft haben Christen diesen Satz geschrieben, gehört und geglaubt!?
„Die Welt geht bald unter“.
Ich gebe zu, dass die momentane Weltlage durchaus Anlass gibt.
Die Erwartung der Endzeit ist Bestandteil unserer christlichen Lehre.
Weltuntergang, Wiederkunft Christi, Allgemeine Totenauferstehung, Jüngstes Gericht, Vollendung des Reiches Gottes – das alles verbinden wir Christen mit dem Satz unseres Predigtabschnitts „Das Ende aller Dinge ist nahegekommen!"
Wie gehen wir aber damit um?
Welche Bedeutung hat die Rede vom Weltende für uns heute?
Vielleicht helfen uns bei der Beantwortung vier Szenen aus der Geschichte:
1. Szene: 1963 Mont Blanc:
Tausende von Jehovas Zeugen drängen in die Seilbahnen zum Mont Blanc.
Sie wollen den von ihnen genau datierten Weltuntergang von der Mont-Blanc-Spitze aus kniend und betend erleben.
Steinreiche Manager und Ärzte haben all ihren Besitz verkauft oder verschenkt, weil sie Jehova entgegen schweben wollen.
Die Seilbahnschaffner werden verrückt von der Ekstase und Psychose der Endzeit-Pilger.
Drei Tage verharren sie in der Kälte auf der Bergspitze.
Dann kehren sie deprimiert zurück.
Ihr Irrglaube an das Weltende hat sie abgehalten, in der Welt Gutes zu tun.
2. Szene: 1525 Frankenhausen:
Thomas Müntzer und seine Anhänger wollen mit Lanzen und Hellebarden für ihre berechtigten Bauern-Rechte kämpfen.
Völlig unterlegen rücken sie gegen die gut geharnischten Truppen der Fürsten vor.
Plötzlich sehen sie einen riesigen Regenbogen: das Zeichen für den Anbruch der Endzeit und für ihren unweigerlichen Sieg.
Sie rücken vor.
Das Resultat kennen wir: Tausende Bauern werden hingemetzelt.
Thomas Müntzers Glaube an den Anbruch der Endzeit hat seine Revolution beflügelt und ihn abgehalten, Frieden und Versöhnung zu suchen.
3. Szene: 1525, gleiches Jahr, Wittenberg: Albrecht Dürer hat einen eindrucksvollen Kupferstich geschaffen „Die apokalyptischen Reiter".
Er war, wie viele seiner Zeitgenossen überzeugt, dass 1526 das Weltende anbrechen wird.
Viele glaubten an eine Feuersbrunst und an ein Verglühen alles Lebendigen.
Dürer ließ sich dadurch von seiner Arbeit nicht abhalten.
Er schuf weiterhin großartige Bilder und er betätigte sich, wie wir wissen, sehr sozial.
Martin Luther wusste ebenfalls vom Weltuntergangs-Datum 1526.
Wie ernst er es nahm, ist mir nicht bekannt.
Aber sein Verhalten war typisch: Er heiratete im Herbst 1525 – trotz Weltuntergang.
Er soll ja gesagt haben: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen."
4. Szene: Anno 90 nach Christus Palästina:
Junge Christen werden brutal angegriffen, weil sie das Kaiser-Bild nicht anbeten, weil sie dem gekreuzigten Verbrecher Jesus von Nazareth als auferstandenem Christus mehr vertrauen und weil sie an ein bevorstehendes Weltende glauben.
Sie erhalten in ihrem Leiden Trost durch einen Brief, den sog. 1. Petrus-Brief.
Darin wird ihnen bestätigt, dass die Endzeit irgendwann anbricht und Christus wieder kommen wird.
Aber auf eine terminliche Festlegung verzichtet der Briefautor.
Und noch deutlicher:
Er verbietet jegliche Weltflucht, z.B. auf einen Mont Blanc; und er verbietet jegliche Revolution im Angesicht des Weltendes, wie in Frankenhausen.
Im Gegenteil: Er fordert die Christen auf, Liebe üben, zum Dienst bereit zu sein und Gäste aufzunehmen, was aufwendig war und viel kostete;
So als ob kein Weltende bevorstünde.
Ja, er fordert sie auf, auch ihren Peinigern mit Liebe und nicht mit Gewalt zu begegnen.
Das bevorstehende „Ende aller Dinge", so der Briefautor, sollten sie als Grundlage sehen, Gutes zu tun und nicht zu fliehen.
„Übt Liebe!", ruft er ihnen zu, „so, wie auch Christus vor seinem Ende Liebe geübt hat.
Ihr habt schon Gottes Versöhnung und Liebe erlebt.
Nun versöhnt auch ihr euch und übt Liebe, - bis Gottes Reich der Liebe endgültig anbricht."
Liebe Gemeinde,
ihr erahnt schon, warum ich gerade diese vier Szenen vom Umgang mit dem Weltende ausgewählt habe:
Die ersten beiden Szenen zeigen die Lieblosigkeit und Hartherzigkeit, die entstehen kann, wenn man fest an ein bevorstehendes Weltende glaubt.
Der Aufstieg auf den Mont Blanc 1963 war herzlos.
Thomas Müntzers Revolution im Mai 1525 war möglicherweise notwendig, aber unter Ausnutzung des geglaubten anbrechenden Weltendes eine Untat.
Gab er doch den Fürsten Anlass für ihr maßloses Abschlachten der Bauern.
Dürers und Luthers Verhalten zeigen dagegen:
Trotz des geglaubten bevorstehenden Weltendes stehen wir Christen weiter in der Verantwortung: Hoffnung und Liebe in der Welt zu verbreiten und damit den Menschen ein gutes Ende zu ermöglichen.
Das ist auch der Sinn der Worte im 1. Petrusbrief:
Seid besonnen und nüchtern zum Gebet.
Übt angesichts des „Endes aller Dinge" Gastfreiheit und Nächstenliebe.
Liebe Gemeinde,
„Welche Bedeutung hat die Rede vom Weltende für uns heute?“
Was tun wir angesichts des Endes?
Die Antwort auf diese zugegeben schwierige Frage hängt von unserer Einstellung zum Leben und vor allem zum Schöpfer des Lebens ab.
Die ersten Christen damals mussten viel aushalten und leiden.
Und es gab sicherlich auch viele, die daran fast verzweifelt sind und sich gerne zum Richter über ihre Peiniger aufgespielt hätten.
Unser Predigtwort erinnert dagegen an etwas anderes:
Euch Christen ist noch Zeit geschenkt!
Zwischenzeit; Zeit der Bewährung;
Zeit zwischen Christus, der euch Gottes Liebe und Versöhnung vorgelebt hat, und dem bald anbrechenden Reich Gottes, in dem endgültige Liebe und Versöhnung herrschen werden.
Versteht diese Zwischenzeit als Chance, als Gnadenzeit!
Stellt euch trotz allem in den Dienst der gerechten Sache.
Stellt euch in den Dienst der Liebe Gottes.
Übt Liebe und Gastfreundschaft – trotz allem.
Dient der Sache Gottes!
Was kann das für uns heute heißen?
Uns geht’s doch eigentlich ganz gut.
Keine Verfolgung!
Lange Lebenserwartung.
Soziale Absicherung.
Einigermaßen Frieden in unserm Land.
Religionsfreiheit.
Stört da nicht eher die Rede vom Ende der Welt, vom Ende des Lebens?
Dazu möchte ich ein Erlebnis schildern, das mich als Jugendlicher stark beeindruckt hat.
Wir waren im Krankenhaus, um meine Oma zu besuchen.
Ich war damals 15 Jahre alt.
Auf dem Flur begegneten wir einem Pfleger.
Mein Vater war sehr überrascht, ihn im weißen Kittel zu sehen, denn er kannte ihn aus seinem Beruf als Einkäufer bei einem großen Baustoffhändler.
Darauf angesprochen erzählte der Krankenpfleger, dass die Ärzte vor einigen Wochen Krebs festgestellt hätten.
Unheilbar, Lebenserwartung sechs Monate, vielleicht ein Jahr.
Mein Vater war geschockt, ich auch.
Aber der Mann fügte mit einem Lächeln hinzu.
„Ich beschlossen, noch was Sinnvolles zu machen – solange ich noch kann.
Ich hab’ meinen alten Beruf gekündigt und helf’ jetzt hier mit.“
Er hat kurz freundlich gegrüßt und ist mit seiner Bettpfanne in einem Krankenzimmer verschwunden.
Dieser Mann war wirklich beeindruckend.
Und wenn ich’s nicht selber erlebt hätte, würde ich’s vielleicht nicht glauben.
Denn es gibt ja auch genügend Beispiele dafür, dass Menschen aus ihrer letzten Lebenszeit noch alles rauspressen, was geht.
Doch unsere Lebensperspektive ist eine andere:
Wenn das Ende unserer Lebenszeit naht, dann droht uns nicht die Aussicht auf ein absolutes Nichts – auf ein Aus-und-Vorbei.
Das Ende des Lebens ist aus der Sicht des Glaubens ein Neuanfang.
Die Ewigkeit beginnt schon jetzt im bewussten Umgang mit meinem Leben und dem Leben meiner Mitmenschen.
Aus der Endzeit meines Lebens wird Gnadenzeit, wenn wir beten, wenn wir Liebe und Gastfreundschaft üben.
Die Kraft dazu schenkt uns Gott, gerade dann, wenn unsere Kräfte schwinden.
Aus dieser Perspektive spricht Hoffnung und Sinn trotz aller Widrigkeiten des Lebens.
Für Gott gibt es kein Ende.
Mit Gott gibt es für uns immer einen neuen Anfang.
Das hat er uns in Jesus Christus gezeigt.
Durch sein Kreuz und seine Auferstehung ist der Tod besiegt.
Und wir haben an diesem Sieg Anteil.
Möge uns Gott beim Nachdenken über das Ende der Welt und vor allem über unser persönliches Lebensende ein getröstetes und hoffnungsvolles Herz geben.
Ein Herz voller Mut und Zuversicht, das die Gnadenzeit nützt.
Ein Herz das sich verschenkt und das zur Hoffnung für andere in Not und Verzweiflung wird.
Ein Herz, in dem das Gottvertrauen immer wieder Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen lassen,
mit denen auch wir sagen können:
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.
Der Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.